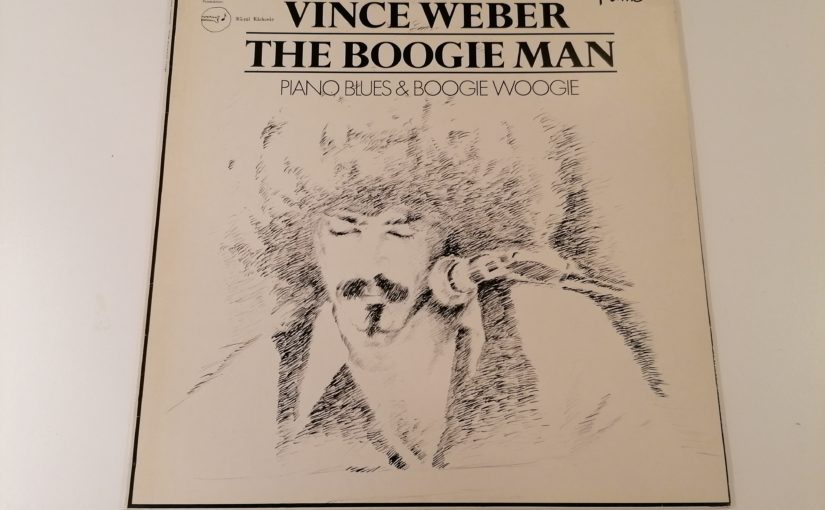Samstag ist Reportagentag auf den Auslandsseiten im “Luxemburger Wort”, der Zeitung, für die ich seit sechs Jahren als Onliner arbeite. Das heißt, im Politikteil berichten Korrespondenten aus dem weiten und nahen Ausland über alles Mögliche – zuletzt aus Litauen, oder aus Brandenburg vom neuen Tesla-Werk, aber auch von einem Roma-Ghetto in Süditalien.
Für das vergangene Wochenende war noch nichts Genaues festgelegt, als mein Kollege Michael Merten mich fragte, ob wir aus Saarlouis über die spektakuläre Wende im Mordfall Samuel Yeboah berichten wollten. Sprich, nicht nur nachrichtlich verkünden, dass nach mehr als 30 Jahren ein tatverdächtiger Neonazi festgenommen wurde, sondern näher dran und tiefer rein. Wir könnten in der Print-Version die Auslands-Doppelseite haben, online dürfe es ein sogenannter “longread” werden – ein langes Stück mit vielen Fotos.
(Abkürzung: Wurde es dann auch, es heißt “Den Namen pfeifen in Saarlouis die Spatzen von den Dächern“.)
Okay, dachte ich. Bis nach Saarlouis sind es von Luxemburg etwa 50 Kilometer, aber schließlich ist eine Grenze dazwischen. Ausland genug. Ich bin im Thema, hatte schon vor einem Jahr was dazu geschrieben, dass der Fall wieder aufgerollt würde und halb Saarlouis den Täter kennt. Also fuhren wir an einem Mittwoch ins Saarland, um Leute zu treffen, die sich zum Teil fast seit dem Tattag mit dem Fall, einem rassistisch-rechtsextrem motivierten Mordanschlag, beschäftigen.
Erst unterwegs wurde mir klar, dass ich mit dieser Recherche nicht nur zum Auslandskorrespondenten, sondern auch zum Berichterstatter aus meiner eigenen Vergangenheit wurde. Dass ich deswegen im Thema bin, weil Samuel Yeboah zu einer Zeit an einem Ort starb, die in gewisser Weise meine Zeit und mein Ort sind.
Ich bin jetzt 45 und im Landkreis Saarlouis aufgewachsen. Als die Mauer fiel, weit weg, war ich zwölf, als Samuel Yeboah starb, sehr nah, war ich 14. Der aufkommende Rassismus (“Fremdenhass” oder “Ausländerhass” sagte man damals noch dazu) aus der Nachwendezeit fiel genau in die Phase, in der ich mich für Politik zu interessieren begann. Das übrigens kirchlich organisiert, als Teil einer örtlichen Gruppe der “Christlichen Arbeiterjugend” – obwohl ich von deren drei titelgebenden Attributen streng genommen nur eines so richtig erfüllte.

Bei der CAJ war Rassismus ein Thema, das wir gründlich beackerten. Ich erinnere mich an sehr viel inhaltliche Arbeit, an viele Veranstaltungen “gegen rechts”, gefühlt fast jedes Wochenende. An Aufkleber mit Slogans wie “Mein Freund ist Ausländer”, “Enjoy your neighbour’s culture” oder “Mach meinen Kumpel nicht an”. Lebhaft an die riesige Demo kurz nach dem 19. September 1991 in Saarbrücken mit angeblich 20.000 Teilnehmern. An ein Soli-Konzert gegen Ausländerhass mit meiner ersten Band 1993 im Hof des Saarlouiser Orannaheims – einer Asylbewerberunterkunft, in der im Jahr zuvor eine Rohrbombe noch rechtzeitig entdeckt worden war. Den Bewohner*innen war unser Auftritt recht egal, Abwechslung schien zwar willkommen, manche wirkten aber auch schlicht genervt.
Dass man gegen Nazis war, war Konsens. Allerdings war das ganze Thema, so präsent es auch war, in meinem Umfeld eher theoretisch vorhanden. Ich kannte keine Geflüchteten in Heimen. Und auch keine Skinheads. Dass in den Stadtparks in Saarlouis und Dillingen mitunter das Faustrecht regierte, wusste ich aus Erzählungen. Skinheads waren für mich so eine Art Comic-Schurken, ein bisschen wie die Daltons, aber gefährlicher. An dieser Vorstellung änderte auch das Schulhof-Gerücht nichts, dass sie angeblich einem Dillinger Skater “mit einer Rasierklinge die Mundwinkel aufgeschnitten und ihm sein Skateboard zu fressen gegeben” hätten. Skater kannte ich auch kaum welche.
Auf der Recherchetour in Saarlouis habe ich dann Leute getroffen, für die Rechtsextremismus überhaupt nichts Theoretisches, sondern etwas sehr Praktisches war. Einen der Interviewpartner kenne ich seit dem Kindergarten, irgendwann mit 16 oder 17 trennten sich die Wege. Wir haben uns bestimmt 20 Jahre nicht gesehen. Ich wusste, dass er damals einer von den Stadtpark-Punks war, aber nicht genau, was das bedeutete. Als er von den frühen Neunzigern in Saarlouis erzählt, fallen die Worte “Straßenterror”, “Übergriffe” und “täglich”. Mit Arbeitskreisen, Benefizkonzerten und hübschen Slogans hatte das wenig zu tun.
Die zwei Gesichter von Saarlouis
Es ist nicht so, als sei ich vergangene Woche zum ersten Mal “seit damals” wieder in Saarlouis gewesen, oder nach Jahrzehnten in der Fremde “nach Hause gekommen”. Das Gegenteil ist der Fall, ich bin noch oft in Saarlouis und Umgebung – sogar erst in der Woche davor zu einer Familienfeier in einem Restaurant in der Altstadt. Aber als wir uns nach den ausführlichen Gesprächen in der Stadt auf die Spurensuche nach Samuel Yeboah und den Neonazis machen, wirkt Saarlouis auf mich komplett anders als sonst.
Man darf in solchen Situationen nicht das Reportageziel aus den Augen verlieren, aber auch nicht an jeder Ecke zu finden versuchen. Und sollte auch der Versuchung widerstehen, ein bestimmtes Narrativ, in diesem Fall das von Saarlouis als rechtsextremistischer Hochburg, ungefiltert in die Story zu packen. Denn man wird mit dem entsprechenden Hintergrund im Hinterkopf an jeder Ecke Symbole sehen.

Was uns in Saarlouis aber an Symbolik entgegenschlug, war schon bemerkenswert. Am Großen Markt klebt direkt vor der Touristinfo ein rechter Slogan an einem Laternenmast: “Heimatrecht ist Menschenrecht, auch für uns Deutsche”. Ein Spruch, der direkt aus dem Jahr 1991 stammen könnte, aber der Aufkleber ist neu.
Der mutmaßliche Täter Peter Werner S. traf sich am Tatabend mit zwei weiteren Nazis nicht irgendwo, sondern im “Bayerischen Hof”, in der Adlerstraße. Die Kneipe gibt es nicht mehr, an der Stelle, wo sie sich befand, wird grade renoviert. Die Adlerstraße führt vom Großen Markt rechts am Rathaus vorbei und ist nicht sehr breit, wer aus der Kneipentür drei Schritte über die Straße macht, berührt fast die Rathauswand. Bemerkenswert für eine Stadt, deren Oberhäupter – übrigens von SPD und CDU – sich in den vergangenen 30 Jahren durch das Wegreden einer organisierten rechten Szene hervortaten.
Samuel Yeboah liegt auf dem Friedhof “Neue Welt” in Saarlouis-Picard begraben. Warum der Friedhof bzw. das umliegende Stadtviertel so heißt, ist – zumindest mir – nicht ganz klar. Aber man muss sich schon aktiv ermahnen, keinen Zusammenhang zu Yeboahs versuchtem Neuanfang in Saarlouis und seinem brutalen Ende in seiner neuen Welt herzustellen. Am Grab selbst fällt auf, dass es das einzige in der Reihe ist, vielleicht liegt das aber auch daran, dass die Frist zur Einebnung aufgehoben wurde. Die Urnengräber in der Reihe gegenüber wirken ungepflegt, tragen zum Teil schon den roten Aufkleber, dass sie zur Einebnung vorgesehen sind. Vielleicht ist es also nur eine Momentaufnahme, die es so wirken lässt, als gehöre Yeboah nicht dazu – aber an diesem Mittwoch sieht es tatsächlich so aus.
Nazis und Nationalchauvinismus
Überbordend ist die Symbolik dann im “Löwenpark”, und das ist natürlich Absicht. Die Grünanlage heißt eigentlich “Ludwigspark”, zu Ehren Ludwigs XIV., der die Festung Sarre-Louis 1680 von seinem Baumeister Vauban errichten ließ. Der Löwenpark ist deutlich kleiner als der Stadtgarten, nur zwei Steinwürfe entfernt vom damaligen freien Kulturzentrum KOMM im alten Betriebshof und der linken Kneipe “Café Wichtig”, trafen sich hier die Saarlouiser Skinheads und duldeten neben sich keine anderen Subkulturen, so erzählen es zumindest die Zeitzeugen.
Für den Spitznamen des Parks verantwortlich ist eines der heftigsten nationalchauvinistischen Kriegerdenkmäler, das ich jemals irgendwo gesehen habe: ein brüllender Bronze-Löwe zu Ehren der Gefallenen des Rheinischen Feldartillerieregiments von Holtzendorff. Das Denkmal steht seit den 1920ern, der Löwe ist eine Nachbildung des Originals, das womöglich im Zweiten Weltkrieg eingeschmolzen wurde, um neue Kanonen zu produzieren. Dass man 1958 nichts Besseres zu tun hatte, als einfach einen neuen Löwen mit unveränderter Aussage zu gießen, spricht für sich. Die umlaufende Schrift lautet “Den gefallenen Kameraden in Deutschlands Heldenkampf” darunter sind Schlachtorte aus dem Ersten Weltkrieg aufgezählt. Man braucht nicht viel Fantasie, um zu verstehen, warum die Nazis sich lieber hier betrunken haben als woanders.
Wir verlassen Saarlouis und machen uns ans Schreiben. Wir haben beide den Schreibtisch ziemlich voll, dieser Job ist eingeschoben, weil wir eine Gelegenheit nutzen wollten. Mit der Ausbeute des Tages in Saarlouis und Dillingen sind wir zufrieden, dennoch bin ich nachdenklich, ob es ausreicht. Bei jedem längeren Text, den man für eine Veröffentlichung schreibt, vor allem bei denen mit einer gewissen Faktentiefe, schluckt man eine Unmenge an Informationen in sich hinein, die man im Kopf so gut wie möglich unter Kontrolle zu halten versucht, bevor man sie in kondensierter, getrimmter Form wieder von sich gibt. Zur Deadline ist man fertig, im Idealfall. Aber trotz professioneller Distanz gibt es Geschichten, die einem noch ein paar Tage nachhängen. Zu denen gehört diese hier.
Mehr dazu:
- Den Namen pfeifen die Spatzen von den Dächern.
- Saarlouiser Rechtsextremist nach 30 Jahren festgenommen
- Bewegung im Fall Samuel Yeboah
- Die Hintergründe
Ein Wort zur Paywall:
Ja, meine/unsere Texte hinter den Links kosten Geld. Unser Arbeitgeber bezahlt uns auch dann, wenn wir einen ganzen Tag in Saarlouis rumhängen und über alte Geschichten reden. Und dann noch einen Tag brauchen, um all das aufzuschreiben. Nein, leider kann man die Artikel nicht einzeln kaufen. Das wäre mir beim Verlinken manchmal auch lieber, auch ich habe nicht immer Lust, gleich ein Abo abzuschließen. Aber ich entscheide das nicht.